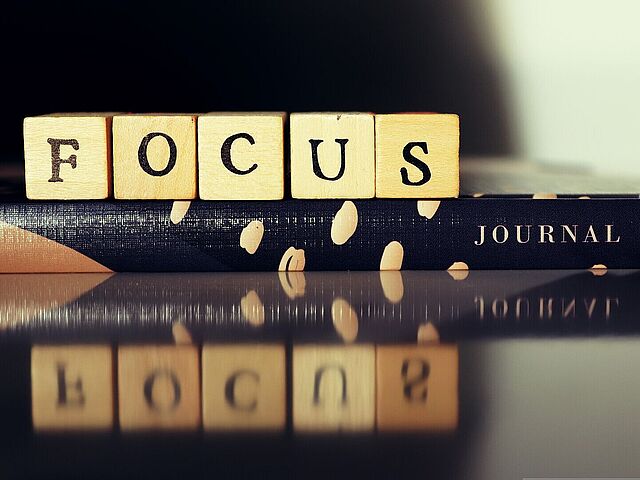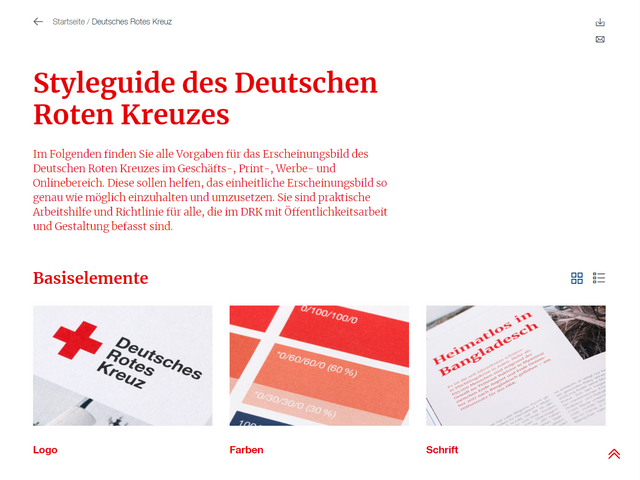Vollständige Biografie - Marie Simon
Die Sorbin, geboren am 26. August 1824 in Doberschau bei Bautzen, wächst auf dem Hofgut ihres Großvaters auf. Als Jugendliche bringt sie sich selbst pflegerische Kenntnisse bei und hospitiert im Diakonissenkrankenhaus in Dresden und in der Universitätsklinik in Leipzig. Mit 22 Jahren zieht sie nach Dresden, heiratet dort 1846 und führt mit ihrem Ehemann Friedrich Anton am Altmarkt 26 ein Spitzen- und Weißwarengeschäft.
Während des deutsch-österreichischen Krieges im Sommer 1866 sucht Marie Simon die Schlachtfelder in Böhmen auf, wo sie hunderte von Verwundeten völlig unversorgt vorfindet. Zurück in Dresden wird sie von dem gerade 5 Wochen zuvor gegründeten „Internationalen Verein zur Pflege im Kriege verwundeter und kranker Soldaten für das Königreich Sachsen“ beauftragt, Hilfe zu organisieren. Mit Rotkreuz-Armbinde und großen Mengen Verbandsmaterial kehrt sie nach Böhmen zurück, um verwundete und kranke Soldaten zu versorgen. Sie organisiert den Rücktransport der Verwundeten in die Heimat und setzt dabei durch, dass auch die preußischen Verwundeten, die auf der gegnerischen Seite gekämpft hatten, mitgenommen werden.
Kronprinzessin Carola von Sachsen beruft Marie Simon als einzige Bürgerliche in das Direktorium des im September 1867 gegründeten Albertvereins. Ihre Aufgabe ist dort die Ausbildung der Krankenpflegerinnen und die Leitung der Armenkrankenpflege.
Der nächste Einsatz kommt im deutsch-französischen Krieg 1870/71. Sie arbeitet 7 Monate lang ohne Unterbrechung als Krankenschwester und Lazarettköchin und leitet den Einsatz der Albertinerinnen. Wohl nicht ohne Grund ist sie zu Beginn des Einsatzes angewiesen worden, nichts eigenmächtig zu unternehmen. Dazu schreibt sie einer Freundin: „Aber ich nehme es nicht so streng, und werde nicht müßige Zuschauerin bleiben, so es zu handeln gilt …“ Mit dieser menschenfreundlichen Haltung und ihrer unparteilichen und resoluten Tatkraft ist sie erfolgreich und tut viel mehr, als nur ihre Aufgabe zu erfüllen. Ihre unerschrockenen Taten werden verbreitet und bewundert; Zeitgenossen nennen sie „Mutter Simon“ und „la Nightingale allemande“.
Ihre Erlebnisse als leidenschaftliche Krankenpflegerin, ihre Erfahrungen und ihr fachliches Wissen veröffentlicht sie in einem Buch mit Briefen und Tagebucheintragungen und in einem Lehrbuch zur Krankenpflege. Unermüdlich kämpft sie dafür, die Krankenpflege zu professionalisieren und als Beruf für Frauen zu etablieren: ihr Beitrag zur Emanzipation der Frauen. Ihre Streitbarkeit sorgt für Anerkennung und Sympathien, aber auch für Anfeindungen. Menschlichkeit, unparteilich und Internationalität – die elementaren Grundsätze der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung – verwirklicht und verkörpert sie. In der Gründungsphase des Roten Kreuzes beweist sie im Königreich Sachsen den praktischen Nutzen der neuen humanitären Bewegung in der Krankenpflege und bei Hilfsoperationen im Feld.
Für diese beiden Aufgaben, die auch heute die wesentlichen Säulen unserer Arbeit im Roten Kreuz sind, legt sie die Fundamente und konkretisiert so die Ideen Henry Dunants, der sie als „Vorbild der werktätigen Barmherzigkeit“ lobt.
Weil sie mit einfachen Mitteln und freiwilligem Engagement anpackt, um Menschen in Not zu helfen, taugt Marie Simon auch heute als Vorbild für Helferinnen und Helfer im Roten Kreuz.
1872 gründet Marie Simon die „Deutsche Heilstätte für Invalide und Kranke“ in Loschwitz bei Dresden, eine Klinik zur Nachbehandlung von Kriegsbeschädigten, der eine Ausbildungseinrichtung für Krankenpflegerinnen angeschlossen ist ; alles mit eigenen Mitteln und Spenden finanziert. Die Heilstätte existiert bis 1912, wird im 1. Weltkrieg als Lazarett genutzt und ist heute eine Wohnanlage.
Marie Simon ist eine mutige, unerschrockene Frau mit gewaltiger Energie, die sich immer wieder bestimmt und resolut gegen Obrigkeiten durchsetzt, um Verwundeten und Kranken zu helfen. Sie ist berühmt, hochgeachtet und wird vielfach ausgezeichnet; schon 1867 erhält sie während des ersten Kongresses der Genfer Konvention eine Goldmedaille für ihre Verdienste um die Krankenpflege, genauso wie Florence Nightingale.
Am späten Abend des 20. Februar 1877 stirbt Marie Simon an einer Nierenentzündung im Alter von nur 52 Jahren.